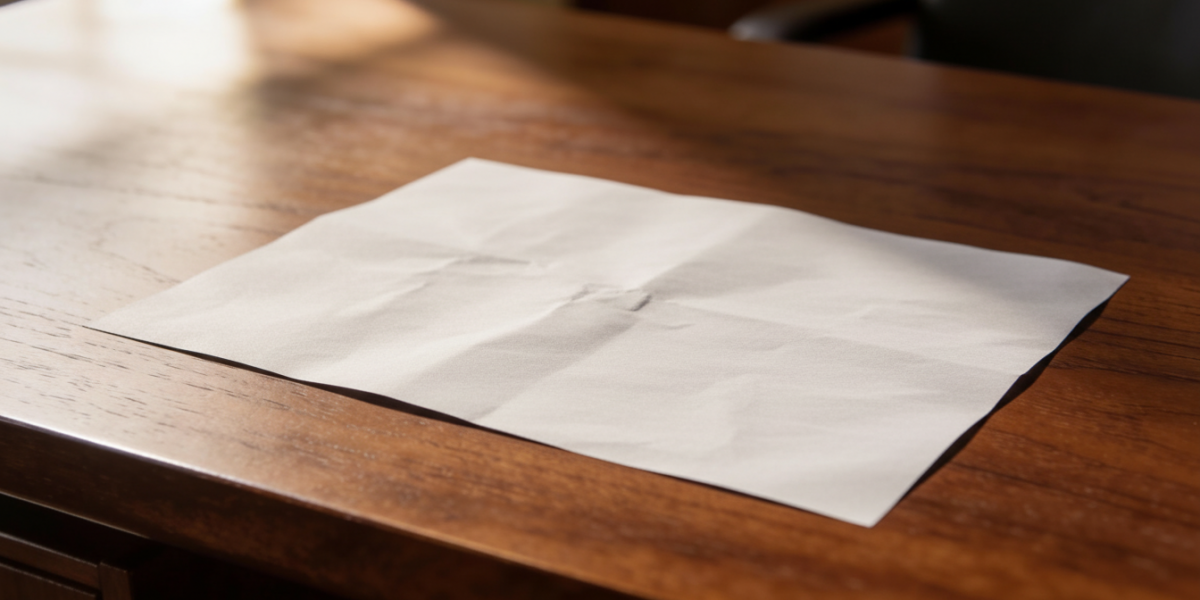Die digitale Öffentlichkeit der Bundestagswahl 2025
In meiner letzten Seminararbeit im Wintersemester habe ich mich ausführlich mit der digitalen (politischen) Öffentlichkeit im Rahmen der Bundestagswahl 2025 beschäftigt und einen Zeitraum beleuchtet, der sowohl Aspekte kurz vor der Wahl und auch nach der Wahl berücksichtigt hat.
Was ist die digitale Öffentlichkeit?
Die digitale Öffentlichkeit bezeichnet einen Raum, welcher parallel zur klassischen Öffentlichkeit existiert und die Aspekte der klassischen Öffentlichkeit in die digitale Sphäre ausweitet. Dabei umfasst sie ungefähr die gleichen Aspekte, nur in digitaler Form. So können sich Nutzer zum Beispiel in sozialen Netzwerken austauschen und somit am Geschehen der Öffentlichkeit teilnehmen. Dies kann unter anderem in Form des Likens, Teilens, und dem Kommentieren von Beiträgen geschehen. Dabei ergänzt sie (oder verdrängt) klassische Medien, welche in ihren Formen wie Zeitungen, Radio und Fernsehen seit Jahren an Bedeutung verlieren. Insbesondere für junge Menschen hat die digitale Öffentlichkeit eine sehr große Bedeutungskraft, zunehmend steigt die Bedeutung aber auch für ältere Generationen.
Der Wandel der Öffentlichkeit zum Digitalen
Während klassische Medien nur wenig bis keine Form der Partizipation für interessierte Personen bieten konnten, ist es in sozialen Netzwerken möglich, eine breite Schicht an Nutzern zu erreichen und gleichzeitig zahllose Formen für die Partizipation derer zu bieten. In diesem Zusammenhang werden Bürger von passiven Konsumenten zu aktiven Akteuren.
Welche Rolle spielt dies im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2025?
Die Bundestagswahl stellt ein politisches Ereignis von großer nationaler Bedeutung dar, zu welcher digitale Medien (z.B. Social Media, Filmformate, Apps, Webseiten und Blogs) zur Verbreitung von Inhalten genutzt werden. Insbesondere TikTok und Instagram dominieren den Informationsfluss bei jungen Interessenten.
Die Chancen der digitalen Öffentlichkeit
- Niedrigschwelliger Zugang zu politischen Informationen für breite Bevölkerungsschichten.
- Beschleunigte und interaktive Kommunikation zwischen Wählerinnen, Parteien und Kandidatinnen.
- Persönliche Accounts von Kandidaten erzielen mehr Reichweite und Interaktion für die eigenen Interessen und Ziele und sind dabei noch populärer als Partei-Accounts.
- Vielfältige digitale Medienkonzepte ergänzen klassische Wahlberichterstattung (z.B. funk auf Social Media und im klassischen Kontext ARD, ZDF oder RTL im Fernsehen).
Die Risiken der digitalen Öffentlichkeit
- Erhöhte Gefahr durch Fake News, Desinformation und Extremismus.
- Algorithmen bevorzugen polarisierende/emotionale Inhalte, was Fragmentierung und Polarisierung fördert.
- Mangelhafte Kontrolle der Informationsquellen durch Nutzer, Vertrauen in die Korrektheit von Politikerstatements ist hoch, Überprüfung gering. In diesem Kontext verschärfen KI-Werkzeuge das Desinformationsrisiko (z.B. Deepfakes).
In diesem Zusammenhang empfehlenswerte Literatur und Quellen:
- Bitkom (2025): Bundestagswahl 2025. Mediennutzung, Herausforderungen und digitalpolitische Perspektiven.
- Habermas, Jürgen (1990): Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Universum Kommunikation und Medien AG (2025): Social-Media-Analyse der Bundestagswahl 2025.
- Neuberger, Christoph/ Thiel, Thorsten (2022): Demokratie und Digitalisierung. Berlin: Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft und Berliner Landeszentrale für politische Bildung.
- Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft (2025): Weizenbaum Report 2025. Politische Partizipation in Deutschland.
Die volle Seminararbeit kann gerne individuell angefordert werden.